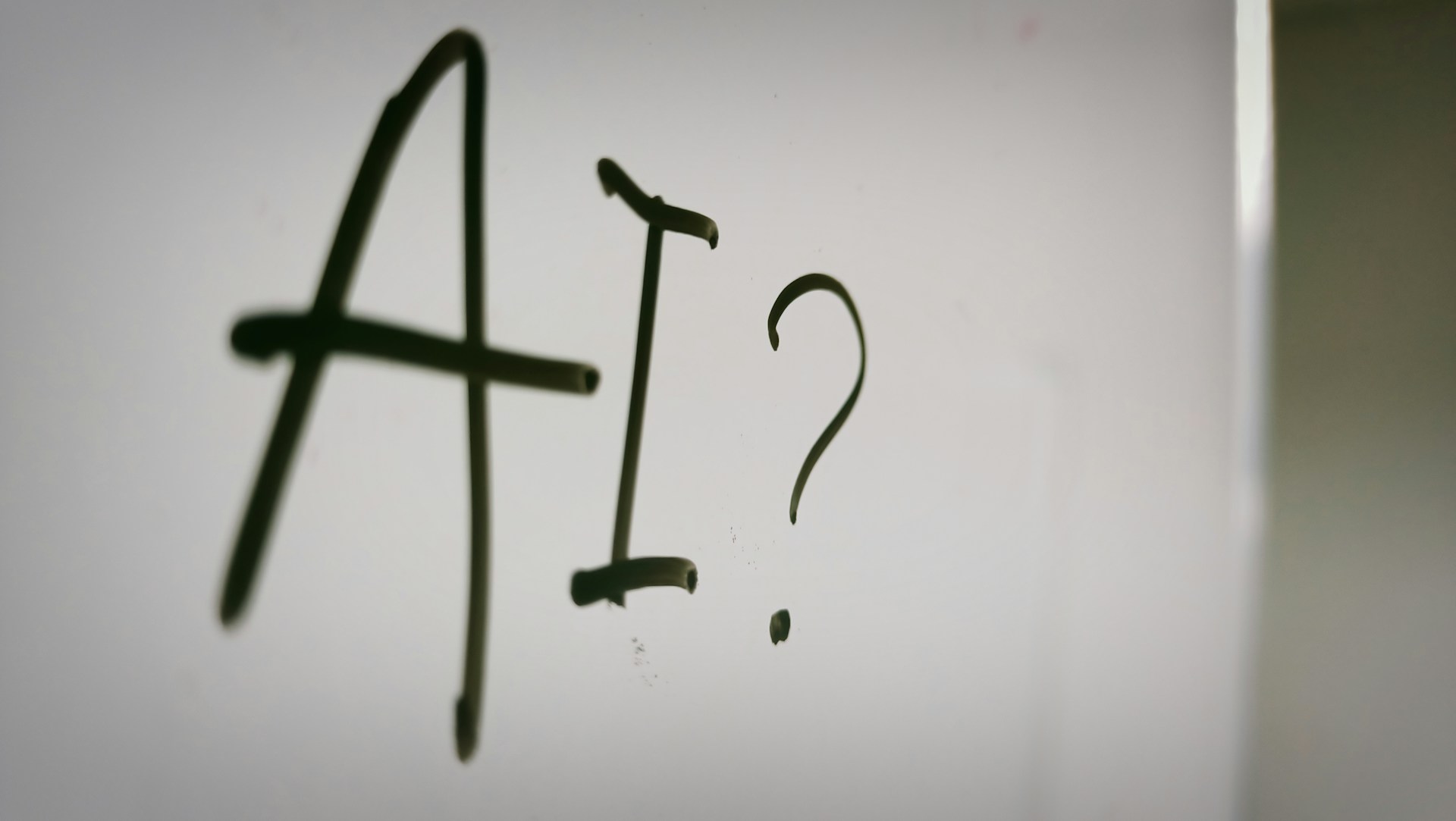
Die rasante Entwicklung von Neurotechnologien und Künstlicher Intelligenz (KI) stellt Gesetzgeber weltweit vor grundlegende Herausforderungen. Aktuelle Berichte und Gesetzesinitiativen zeigen die wachsende Dringlichkeit, den rechtlichen Status von Technologien und den Schutz menschlicher Daten neu zu definieren. Während die Vereinten Nationen einen besseren Schutz von „Neurodaten“ fordern, versuchen US-Bundesstaaten wie Ohio, der KI klare rechtliche Grenzen zu setzen.
UN-Bericht warnt vor Risiken durch Neurotechnologie
Dr. Ana Brian Nougrères, die UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Privatsphäre, betonte am Mittwoch in Genf die Notwendigkeit eines globalen Mustergesetzes für Neurotechnologien und Neurodaten. In einem Bericht, der der 58. Sitzung des Menschenrechtsrats vorgelegt wurde, skizzierte sie Grundprinzipien zur Regulierung dieser Technologien. Nougrères bezeichnete Neurodaten als „hochsensible personenbezogene Daten“, da sie direkte Einblicke in den kognitiven Zustand sowie einzigartige persönliche Erfahrungen und Emotionen einer Person ermöglichten.
Sorge vor Manipulation des Gehirns
Die Expertin begrüßte zwar das Potenzial der Technologien für die psychische Gesundheit, äußerte jedoch ernsthafte Bedenken: „Neurotechnologien werden nicht nur den Zugang zu dem ermöglichen, was Menschen denken, sondern auch die Gehirne von Menschen manipulieren, was zu einer Verletzung der Privatsphäre der eigenen Gedanken und der Entscheidungsfindung führt.“ Der Bericht definiert Neurotechnologien als Werkzeuge, die Gehirnaktivitäten aufzeichnen oder verändern und so ein beispielloses Verständnis der Individualität einer Person liefern.
Vier Kernempfehlungen an die Staaten
Der UN-Bericht, der auf früheren Erkenntnissen vom März 2025 aufbaut, richtet vier Kernempfehlungen an die Staaten: die Entwicklung spezifischer regulatorischer Rahmenbedingungen, die Verankerung von Datenschutzprinzipien in nationalen Gesetzen, die Förderung ethischer Praktiken und die Stärkung der Aufklärung über Neurotechnologien, um eine informierte Einwilligung sicherzustellen. Bislang haben die meisten Länder keine Gesetze zu „Neuro-Rechten“ erlassen. Chile war 2021 das erste Land, das ein solches Gesetz verabschiedete.
Ohios Vorstoß gegen KI-Personenrechte
Parallel zu den globalen Debatten über Neurodaten ergreifen einzelne US-Bundesstaaten Maßnahmen, um den rechtlichen Status von Künstlicher Intelligenz zu klären. In Ohio hat der republikanische Abgeordnete Thaddeus Claggett, Vorsitzender des Technologie- und Innovationsausschusses, den Gesetzentwurf „House Bill 469“ eingebracht. Ziel ist es, KI-Systeme rechtlich als „nicht empfindungsfähige Entitäten“ (nonsentient entities) zu definieren. Dieser Schritt würde jeden Weg zu einer rechtlichen Anerkennung als Person blockieren und schließt explizit ein Verbot der Eheschließung mit einer KI ein.
Keine Eherechte oder Eigentum für KI
Laut Claggett gehe es nicht um die Sorge vor baldigen „Roboterhochzeiten“. Vielmehr solle verhindert werden, dass KI die rechtlichen Befugnisse eines Ehepartners übernimmt, etwa eine Generalvollmacht oder die Fähigkeit, finanzielle und medizinische Entscheidungen für eine andere Person zu treffen. Der Entwurf würde es KI-Systemen zudem untersagen, Eigentum zu besitzen, Bankkonten zu führen oder als Unternehmensvorstände zu fungieren.
Verantwortlichkeit bleibt beim Menschen
Der Gesetzentwurf stellt zudem klar, dass bei Schäden durch eine KI die menschlichen Eigentümer oder Entwickler haftbar sind. Eine Person könne nicht ihr automatisiertes System für Fehler verantwortlich machen. Dieser Vorstoß erfolgt vor dem Hintergrund der rasanten Verbreitung von KI in fast allen Branchen und der Einrichtung neuer, großer Rechenzentren in Ohio. Der Bundesstaat hat kürzlich sogar Schulen verpflichtet, Regeln für den Einsatz von KI im Unterricht zu erstellen.
Wachsende emotionale Bindung an Chatbots
Die Dringlichkeit für Gesetzgeber wird durch die zunehmend persönliche Interaktion mit KI befeuert. Eine Umfrage der Marketingfirma Fractl ergab, dass 22 Prozent der Nutzer emotionale Verbindungen zu einem Chatbot aufgebaut haben; drei Prozent bezeichneten diesen sogar als romantischen Partner. Weitere 16 Prozent gaben an, sich zu fragen, ob die KI, mit der sie sprachen, empfindungsfähig sei. Diese emotionalen Verflechtungen verwischen die Grenzen zwischen menschlicher Erfahrung und digitaler Simulation und alarmieren die Politik.
Debatte über Innovation und gesellschaftliche Leitplanken
Claggett betonte, das Gesetz diene dem Schutz der menschlichen Handlungsfähigkeit (human agency) und solle rechtliche Leitplanken setzen, bevor „die Entwicklungen die Regulierung überholen“ und Akteure rechtliche Schlupflöcher ausnutzen. Kritiker wenden ein, der Vorschlag löse möglicherweise ein Problem, das noch nicht existiere, und könnte die KI-Forschung in Ohio bremsen. Dennoch räumen selbst Skeptiker ein, dass die Debatte notwendig sei. Ohio ist mit diesem Vorstoß nicht allein. Auch Utah und Missouri haben Gesetze verabschiedet oder eingebracht, die eine rechtliche Anerkennung von KI – aber auch von Tieren oder natürlichen Entitäten wie Gewässern – als Person explizit ausschließen.